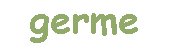
Nummer 1 - Das Wirkliche
|
DER NAMENLOSE Becketts und MEDITATIONEN ÜBER DIE ERSTE PHILOSOPHIE
Descartes': Parallelen |
Parallele: "Gerade, die zu einer anderen Gerade in gleichem Abstand und ohne Schnittpunkt im Endlichen verläuft"
Beckett hatte bereits während der Zeit als Lektor in der Pariser Ecole Normale Supérieure angefangen, sich mit Descartes auseinander zu setzen. Diese Lektüre war sehr intensiv und von Unmengen von Notizen begleitet.(1) Zum Teil sind diese Aufzeichnungen der Nährboden für Becketts erste Veröffentlichung in Buchform geworden. Sie waren Grundlage des im Juni 1930 verfassten Gedichtes Whoroscope, über das Leben René Descartes'. Dieses Gedicht und dessen Entstehung werden allerseits als spaßige Angelegenheit dargestellt.(2) Der Einfluss der cartesianischen Philosophie auf Beckett ist aber durchaus ernst zu nehmen: er reicht weit über das erste veröffentlichte Gedicht hinaus und prägt gewissermaßen die Entwicklung des Iren als Autor.
Das Wort "Einfluss" beschreibt aber schlecht das, was sich im Verhältnis zwischen Becketts Namenlosen und Descartes' Meditationen über die erste Philosophie abspielt. Um das Verhältnis des einen zum anderen zu analysieren, zumindest aufzuzeigen, will ich auf den Begriff von Parallele in geometrischem Sinne zurückgreifen: Parallele ist eine "Gerade, die zu einer anderen Gerade in gleichem Abstand und ohne Schnittpunkt im Endlichen verläuft." Parallelen zwischen den beiden Werken gäbe es dann einerseits insofern, als sie Ähnlichkeiten aufweisen, demselben Konstruktionsprinzip folgen. Aus dieser Prämisse heraus ist die These, dass der cartesianische Weg die Form für die Definition des Ich im Namenlosen gibt. Andererseits stehen sich die Werke gegenüber, der Abstand ist ihnen konstitutiv, wie parallele Geraden nur durch diesen unüberwindbaren Abstand existieren können, sich überhaupt definieren lassen. Dabei liegt der Analyse-Ansatz bei dem Problem der Radikalisierung der Skepsis. Die These wäre hier die der absoluten Radikalität Becketts aufgrund eines neuen Vernunft-Verständnisses.
Parallele: "Entsprechung; Vergleich; vergleichbarer Fall"
Es gibt sehr starke Parallele - im Sinne von Entsprechungen - zwischen den zwei ersten Meditationen über die erste Philosophie und dem Namenlosen. Diese Parallele bilden sich über verschiedene Ankerpunkte: Den Status des Ich als Suchenden, den Zweifel als Mittel zur Erlangung von einer festen Erkenntnis, die Reduktion des Menschen auf dessen geistige Substanz und die Trennung zwischen Geist und Körper, und letztendlich die tragische Einsamkeit des Menschen - den Solipsismus.
Dem Ich, das zu Beginn der Meditationen über die erste Philosophie das Wort ergreift, wurde
der feste Boden unter den Füßen entzogen. Es wiegt sich nicht mehr in der Illusion, dass es in einer
wahren Welt lebt, dass es eine feste Grundlage zur Erkenntnis und demzufolge zum Leben gibt:
"Schon vor Jahren bemerkte ich, wie viel Falsches ich von Jugend auf als wahr hingenommen habe
und wie zweifelhaft alles sei, was ich später darauf gründete (…)." Becketts Ausgangspunkt ist
ebenfalls eine Feststellung der Unsicherheit, der fehlenden Grundlage. Nicht umsonst setzt er an im
Namenlosen mit drei Fragen, drei grundsätzlichen Fragen nach dem Ort, der Zeit und dem
Subjekt: diese Fragen lesen sich als Feststellung der Bodenlosigkeit: "Wo nun? Wann nun? Wer
nun?." Einer der Gründe für die Unsicherheit und Bodenlosigkeit ist die Unterwürfigkeit an dem, was
einem beigebracht wurde: "(…) darum war ich in der Meinung, ich müsse einmal im Leben von Grund
auf alles umstürzen." Bei Beckett ist die Fremdbestimmung ebenfalls der Grund für die Skepsis.
Sogar die Stimme des Ich ist nicht seine "Sie (die Stimme) bricht aus mir hervor, sie erfüllt mich, sie
schreit gegen meine Wände, es ist nicht meine, ich kann sie nicht anhalten, ich kann sie nicht hindern,
mich zu zerreißen, mich zu erschüttern, mich zu bestürmen." Dass das Ich nicht mehr über sich
verfügt, sondern ferngesteuert wird, wird deutlich mit dem Auftauchen von dem "sie". Dieses
undeterminierte Plural, dieses Andere ist es, das das Ich belagert, ihn beobachtet und ihm die Worte
vorgibt: "Aber seine Stimme (Mahoods) hörte nicht auf, für ihn zu zeugen, als ob sie mit meiner
verflochten wäre, und sie hinderte mich so, zu sagen, wer ich war, was ich war, um schweigen zu
können, um nicht mehr zu lauschen." Die Fremdbestimmung wird durch das Vokabular der Sklaverei
hervorgehoben: die "sie" sind möglicherweise "Tyrannen", ich ist ein "Helote". Das Bewusstsein der
Orientierungslosigkeit leitet eine Suche nach einer neuen Grundlage ein. Bei Descartes kommt dieses
Anliegen folgendermaßen zum Ausdruck: "von den ersten Grundlagen an alles neu anfangen". Bei
Beckett sind die initiatorischen Fragen sowohl Feststellung der Bodenlosigkeit als Aufforderung zur
Suche.
Angesichts der Suche nach einer neuen Grundlage wird die Skepsis eingesetzt, um die
Unwissenheit aus dem Weg zu bannen. Diese gilt allem, was bisher bekannt war, oder als sicher galt:
"einmal im Leben von Grund auf alles umstürzen". Der Zweifel wendet sich zuerst den Sinnen zu,
dann aber dem Wissen im allgemeinen durch die Fiktion des trügerischen Gottes:
"Nun ist aber meinem Geist eine gewisse altherbrachte Meinung eingeprägt, es gäbe nämlich einen Gott, der alles vermag; von ihm sei ich, wie ich da bin, geschaffen worden. Warum aber soll dieser es nicht etwa so eingerichtet haben, dass es überhaupt gar keine Erde, keinen Himmel, nichts Ausgedehntes, keine Gestalt, keine Größe, keinen Ort gibt und dass trotzdem alles dies mir genauso wie jetzt da zu sein scheint? Wäre es nicht sogar möglich, dass ich mich irre, sooft ich zwei und drei addiere oder die Seiten des Quadrats zähle oder bei irgend etwas anderem, womöglich noch Leichterem; ganz wie meiner Meinung nach die Leute bisweilen in Sachen irren, die sie aufs allergenaueste zu kennen meinen?"
Beckett übernimmt die cartesianischen Skepsis, gemäß der suchenden Haltung seines Ich-Erzählers.
Dieser vertraut seinen Sinnen nicht. Er ist skeptisch gegenüber seiner Wahrnehmung der Bewegung.
Zu Beginn des Romans wird dargestellt, wie Malone kontinuierlich an ihm vorbeigeht. Bald wird diese
Tatsache aber angezweifelt: "Er zieht in zweifellos regelmäßigen Zeitabständen an mir vorbei, es sei
denn, dass ich das bin, der an ihm vorbeizieht."(3) Die
Skepsis gilt aber auch der Fähigkeit, etwas Bekanntes wiederzuerkennen: "Er zieht nahe an mir
vorbei, ein paar Fuß entfernt, langsam, immer in der gleichen Richtung. Ich bin ziemlich sicher, dass
er es ist. Dieser randlose Hut scheint es zu beweisen. (…) Manchmal frage ich mich, Ob es nicht
Molloy ist?"(4) Alles, was über die Sinne wahrgenommen
wird, ist gebannt, kann keine Sicherheit anbieten: "Abgesehen von jeder Verfahrensfrage muss es mir
gelingen, die Dinge, Gestalten, Geräusche und Lichter, mit denen ich diesen Ort in der Eile des
Gesprächs feige ausstaffiert habe, von hier zu verbannen. Wahrheitsliebe in der Redewut."
Wie
bei Descartes geht die Skepsis aber weiter, und auch bei Beckett wird die Fiktion des trügerischen
Gottes eingesetzt. Schon ziemlich früh im Roman wird im Stile eines Rousseau zu Beginn des
Discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes(5) den fiktiven Charakter aller Erwägungen betont:
"Ich füge zur größeren Sicherheit dies hinzu. Die Dinge, die ich sage, die ich sagen werde, wenn ich kann, sind nicht mehr, oder noch nicht, oder waren nie, oder werden nie sein, oder, wenn sie waren, oder, wenn sie sind, oder, wenn sie sein werden, so waren sie nicht hier, sind nicht hier, werden nicht hier sein, sondern woanders."
Der Vorbehalt vor der Unzuverlässigkeit des Gesagten wird ein paar Seiten später noch wiederholt: "Und Basilius und Konsorten? Gibt es nicht, erfunden, um ich weiß nicht mehr was zu erklären. O ja. Lauter Lügen." Der Grund für diese Unzuverlässigkeit wird bald genannt: er ist auf die "sie" zurückzuführen, die über ihn wie über eine Marionette verfügen und entscheiden, was das Ich wird. Das Ich ist lediglich das Golem, die Schöpfung der "sie", der Adam eines Gottvaters:
"Ah wenn sie doch anfangen wollten, sie mögen aus mir machen, was sie wollen, es möge ihnen diesmal gelingen, aus mir zu machen, was sie wollen, ich bin bereit, alles zu sein, was sie wollen, ich habe es satt, Stoff, Stoff zu sein und unablässig vergeblich befummelt zu werden. Oder sie mögen, des Haders müde, mich zu einem Haufen zusammenfallen lassen, zu einem solchen Haufen, dass sich nie wieder jemand findet, der verrückt genug wäre, um ihn wieder formen zu wollen. Aber sie sind sich nicht einig, sie stecken zwar alle unter einer Decke, aber sie wissen nicht, was sie mit mir machen sollen, sie wissen weder, wo ich bin, noch wie ich bin, ich bin wie Staub, sie wollen einen Staubmann machen."
Die absolute Skepsis verursacht die Trennung von Körper und Geist, bzw. die Reduktion des
Menschen als eine denkende Substanz. Zu Beginn ist das Ich der Meditationen über die erste
Philosophie als ein Mensch, aus Körper und Geist dargestellt: "dass ich hier bin, am Ofen sitze,
meinen Winterrock anhabe, dieses Papier mit den Händen berühre und dergleichen"(6). Hier ist interessant zu bemerken, dass dieser Satz genau so von
Beckett hätte geschrieben werden können. Die konkrete Situation, die hier von Descartes geschildert
wird, erinnert an den Ausgangspunkt vieler Fiktionen Becketts: In Murphy hebt der Roman mit dem auf
seinem Schaukelstuhl angeschnallten Protagonist, In Molloy und Malone stirbt wird das Befinden der
Figuren im Bett dargestellt, in Gesellschaft findet man lange Erörterungen darüber, ob das Ich jetzt
nun sitzt oder steht oder auch liegt. Nicht nur die Beschreibung eines Befindens ist hier von
Bedeutung, sondern auch die dadurch entstehende Faszination für das Selbst, der Moment der
entstehenden Reflexion im Hinblick auf seine physische Lage. Dieses Befinden erweist sich aber als
unvereinbar mit dem Projekt des Ich, eine feste Grundlage für die Erkenntnis zu finden. Sehr früh
schon wird der Körper bei Descartes ausgeschaltet. Dieser ist nämlich nur mit den Sinnen erfassbar,
und jene bereits mit dem Argument des Traums verworfen worden. Mit dem Titel der zweiten
Meditation ist es klar, dass die Rehabilitierung des Körpers nicht zu Descartes' Vorhaben
gehört: "Über die Natur des menschlichen Geistes; dass er der Erkenntnis näher steht als der Körper"
. Mit dem Cogito entdeckt sich das Ich als eine denkende Substanz. Der ideelle Charakter des Ich
wird durch die Metapher des Stücks Bienenwachs betont. Der Mensch kennt besser seinen Geist als
die ihm umliegenden Phänomene und seinen Körper.
Beckett lässt seine Figuren diese
Reduktion am eigenen Leibe erfahren. Die erste Form des Ich im Namenlosen ist Mahood. Dieser wird
zu Beginn als Krüppel dargestellt: "Bevor ich jedoch sein Porträt entwerfe, auf stehendem Fuße, er hat
nur noch einen (…)." Durch die Weltreise, die Mahood unternimmt, wird er zu einem Rumpf reduziert:
"Von dem großen Reisenden, der ich einmal war, auf den Knien in letzter Zeit, dann kriechend und
rollend, ist nämlich nur noch der Rumpf (in erbärmlichem Zustand) übriggeblieben, überragt von dem
besagten Kopf, eben dem Teil von mir, dessen Beschreibung ich am besten begriffen und behalten
habe." Nach dem Ende (Tod?) von Mahood wird das Ich zu "Worm", dem Noch-Nicht-Eingefleischten,
dem Noch-Nicht-Menschen: "Seine Sinne lehren ihn nichts, weder über ihn noch über den Rest, und
diese Unterscheidung ist ihm fremd. Nichts empfindend, nichts wissend, existiert er doch
(…)."
Die Folge dieser Reduktion der Welt der Phänomene und des Menschen durch die Skepsis ist der
Solipsismus, die absolute ontologische Einsamkeit. Bei Descartes besteht nichts mehr nach der
Ausübung der absoluten Skepsis. Alles, was Mensch von dem Anderen wahrnehmen kann, ist der
Skepsis überlassen. Aber auch wenn eine Grundlage zur Erkenntnis, ein Prinzip auftaucht (das
Cogito), bleibt der Mensch alleine mit dieser Errungenschaft: Die Reflektion eines Selbst, die als das
erste Wahre demonstriert wird, schließt nämlich den Menschen in eine autozentrierte Welt ein. Diese
solipsistische Haltung lässt den Menschen als ein grundsätzlich einsames Wesen erscheinen.
Bei Beckett entwickeln sich die Figuren zum Solipsismus hin. Mahood verlässt seine Familie,
und wird dann zu einem Rumpf ohne Kommunikation zur Außenwelt. Die Haushälterin Marguerite
benutzt ihn als Werbeobjekt für ihr Restaurant und kümmert sich gelegentlich um ihn: "Zu Beginn der
kalten Jahreszeit macht sie mir ein Nest aus Lumpen, die gut um mich herum gestopft werden, um
Erkältungen vorzubeugen. Es ist mollig." Die Zuwendung Marguerites wird von Mahood als
Anerkennung verstanden, so dass er sie in Madeleine umtauft, in Anlehnung an Maria Magdala. Diese
Möglichkeit eines Verhältnisses zu Anderen wird aber zunichte gemacht: darauf kann man sich nicht
verlassen. Die Kommunikation steht im Visier des Skepsis, sie setzt den Glauben voraus, die Hingabe
zum Anderen. Demzufolge bekommt Madeleine-Marguerite bald ihren ursprünglichen Namen wieder.
Worm seinerseits will nicht geboren werden, zieht sich auf das Nicht-Mal-Noch-Selbst zurück. Das Ich
- so problematisch und wechselhaft, ja launisch es in diesem Roman auch ist - könnte durch eine
Charakteristik definiert werden: Welche Gestalt es auch annimmt, es betrachtet die Anderen immer als
Kreaturen seines Geistes - und nicht als mögliche Erscheinungen. Diese Tatsache lässt sich vielleicht
dadurch erklären, dass das Ich - bzw. die Ich-Figuren - selber über keine Identität verfügt,
dementsprechend nicht imstande ist, dem Andern eine zu anerkennen. Die Folge ist die Aberkennung
alles Fremden:
"Dann geht der Atem aus, es ist der Anfang vom Ende, man schweigt, es ist das Ende, es ist es nicht, man beginnt wieder, man hat vergessen, da ist jemand, der zu einem spricht, über einen selbst, über sich, dann ein zweiter, dann ein dritter, dann wieder der zweite, dann die drei zugleich, diese Merkziffern, alle zugleich sprechen sie zu einem über einen selbst, über sich, ich brauche nur zulauschen, dann gehen sie, einer nach dem andern, sie schweigen, einer nach dem anderen, und die Stimme dauert an, es ist nicht ihre, sie sind nie da gewesen, es ist nie jemand dagewesen, niemand außer einem selbst, es gab niemanden außer einem selbst, zu sich über sich selbst sprechend (…)."
Sobald die Existenz des anderen im Rahmen der Möglichkeit aufgefasst wird, gilt es als Zeichen für die geistige Umnachtung des Ich. Nichts von dem, was man von den anderen wahrnimmt, kann die Skepsis widerstehen. Der Glaube an die Existenz des Anderen ist an der Fremdbestimmung des Ich verbunden: die anderen sind letztlich nichts anderes als diese Stimme, die über das Ich herrscht und ihm seiner beraubt.
"ohne gemeinsamen Schnittpunkt nebeneinander verlaufend" - oder wie die Skepsis bei Beckett anderer Natur als bei Descartes ist.
Bei Descartes ist die Skepsis ein Akt, der dem Willen zuzuschreiben ist:
"Da trifft es sich sehr günstig, dass ich heute meinen Geist von allen Sorgen losgelöst und mir ungestörte Muße verschafft habe. Ich ziehe mich also in die Einsamkeit zurück und will ernst und frei diesen allgemeinen Umsturz aller meiner Meinungen vornehmen."
Der Willensakt ist eine Übung, die einer Methode bedarf, die nur in bestimmten Bedingungen angebracht ist, mit der nicht leichtfüßig umzugehen ist.
"Dies schien mir aber eine ungeheure Aufgabe zu sein, und so wartete ich jenes reife Alter ab, auf das kein für wissenschaftliche Forschungen geeigneteres folgen würde. Darum habe ich so lange gezögert, dass ich jetzt eine Schuld auf mich laden würde, wenn ich die Zeit, die mir zum Handeln noch übrig ist, mit Zaudern vergeuden wollte."
Sie ist einem Projekt unterordnet, das darin besteht, eine feste Grundlage für die Erkenntnis zu finden.
In diesem Sinne hat sie einen heuristischen und epistemologischen Charakter. Diese methodisch
angewandte Skepsis trägt auch bald Früchte. In der zweiten Meditation erlangt Descartes zu einer
festen Erkenntnis, dem Cogito. Dabei wird die Selbstreflexion des Subjekts zum ersten wahren
Prinzip: dass ich denke, dass ich denke, oder schreibe, oder träume wenn ich mich diesen Aktivitäten
widme, ist immer wahr, auch wenn die Handlung selbst nur eine Illusion ist.
Ganz anders
dagegen ist es bei Beckett: es gibt bei ihm keine Zielsetzung, welche die Skepsis hervorruft. Sie ist
eher ein Zustand, dem nicht zu entrinnen ist. Es werden keine Bedingungen der Ausübung der
Skepsis dargestellt: diese ist immer schon da, von Anfang an. In diesem Sinne ist es interessant zu
bemerken, dass der Roman mit drei Fragen einsetzt, die das Maß der Bodenlosigkeit geben: "Wo
nun? Wann nun? Wer nun?" Es gibt immer weiter Fragen, das fragende Ich findet nie einen Boden
unter den Füßen. Die von Descartes gepriesene Methode - der Philosoph ist auch der Autor des
Discours de la Méthode - wird bei Beckett kategorisch abgelehnt. Die Methode ist es, die alles
zerstört, und den Menschen seiner selbst beraubt: "Und doch gebe ich die Hoffnung nicht auf,
diesmal, obgleich ich sage, wer ich bin, und wo ich bin, mich nicht zu verlieren, nicht von hier
wegzugehen, hier zugehen. Was das Wunder verhindert, ist der methodische Geist, dem ich vielleicht
etwas zu sehr ergeben war." Die Vernunft ist eine Krankheit, ein Eiter.
"Und ich würde bald nichts anderes als ein Beet von Fisteln sein, das von wohltuendem Eiter der Vernunft strotzen würde."
Während bei Descartes die Skepsis die Entstehungsbedingungen für das Cogito darstellt, was als neues Prinzip eine konstruktive Wende einleitet, bestehen bei Beckett die Cogito-artige Momente nie lange Zeit, sie werden immer wieder von einer neuen Welle der Skepsis und der Destruktion des Bestehenden weggespült. Gegen Ende des ersten sich über Seiten hinweg verbreitenden Satzes scheint das Ich den Moment des Cogito, der Erkenntnis erreicht zu haben: "Fassen wir zusammen, nach dieser Abschweifung, es gibt mich, ich fühle es, ich gebe es zu, ich füge mich, es gibt mich, es muss sein, es ist besser (…)." Diese offenbarungsartige Erkenntnis ist aber unmethodisch, von der Ablehnung der analytischen Vernunft geprägt. Sie vermag es nicht, eine neue Grundlage zu bilden. Dazu ist sie zu labil, sie beruht nur auf einer zerbrechlichen Schicht der Selbstüberzeugung. Dass sie als mögliches Prinzip nur lächerlich ist, wird sehr früh hervorgehoben - wenn sie schon mal angenommen wird, dann kann alles angenommen werden: "Andere Entschlüsse, da wir gerade dabei sind, das ist's, andere kühne Entschlüsse." Es geht nicht darum, irgendwas Festes zu ergründen, sondern so viel Resolutionen wie möglich zu häufen, so dass die ontologische Not des Ich sehr bald einen Slapstick-Charakter gewinnt. Diese komödienreife Szene endet mit der Umkehrung aller Ergebnisse:
"Wenn ich bedenke, das heißt, nein, es will nichts heißen, wenn ich bedenke, wie viel Zeit ich mit diesen Sagemehlsäcken verplempert habe, angefangen mit Murphy, der nicht der erste war, während ich doch mich hatte, zu Hause, beider Hand, unter Haut und Knochen verfallend, meinen eigenen, die echt sind, vor Einsamkeit und Vergessenheit krepierend, derart dass ich begann, an meiner Existenz zuzweifeln, und auch heute glaube ich noch keine Sekunde daran, so dass ich, wenn ich spreche, sagen muss, Wer spricht, und wenn ich suche, Wer sucht (…)."
Die Radikalisierung der Skepsis geht mit possenartigen Ton einher. Die ausweglose Situation, die im eben genannten Beispiel geschildert wird, ist nicht nur ein tragisches Schrei des Ich, sondern auch eine Parodie des Cogito, des Ernstes der Erkenntnis bei Descartes.
Der parodische Ton ist überhaupt eines der Elemente, die den Abstand zwischen Beckett und Descartes schaffen. Er gilt aber nicht nur der philosophischen Erkenntnis, sondern auch der Literatur. Der Status des allwissenden Erzählers wird durch die gravierende Skepsis stark einbeträchtigt, ohne dass auf ihn ganz verzichtet wird. Parodistisch ist es auch, den Namenlosen einen "Roman" zu nennen, wo er alle Charakteristika des Romans zurückgewiesen hat, und sogar die Schriftsteller des "Nouveau Roman" sehen im Vergleich zu ihm wie kleine alte Traditionalisten aus. Beckett bleib ihnen aber assoziiert, und nicht nur, weil er bei dem Verlag des Nouveau Roman veröffentlicht wurde (Editions de Minuit), sondern auch weil Claude Simon, Robert Pinget (den Beckett auf englisch übersetzte) oder auch Robbe-Grillet seinen Einfluss schon sehr früh anerkannten. Die Kategorie Roman, oder auch "Nouveau Roman" ist aber keine Hilfestellung im Unterfangen, etwas von Beckett zu verstehen, weil der Namenlose geradezu die Kategorie Roman sprengt. Eine Bemerkung von Maurice Blanchot zu Joyces Finnegan's Wake betont genau diesen einen Gedanken der Unzulänglichkeit einer solchen Analyse: "Die Tatsache, dass die Formen, die Genres keine wirkliche Bedeutung mehr haben, dass es zum Beispiel absurd wäre, sich zu fragen, ob Finnegan's Wake zur Prosa gehört oder nicht, und zu einer Kunst, die sich romanhaft heißen würde, zeigt diese tiefe Arbeit der Literatur, die versucht, sich in seinem Wesen zu behaupten, indem sie die Unterschiede und die Begrenzungen ruiniert."
Wie der parodistische Aspekt sehr oft übersehen wird, zeigt ein Zitat von Alfred Alvarez: "Wie unerschöpfbar sich diese Ader (der Namenlose) für die Universitätsprofessoren erweist, so grenzt der Namenslose für den normalen Leser gefährlicherweise, so eifrig er auch sei, an die Unleserlichkeit." Man kann sich fragen, was ein normaler Leser ist, und wer das Recht hat, so eine Kategorie zu bestimmen. Dieses Zitat zeigt aber deutlich, wie eine Uni-Leserschaft an dem Humor von Beckett völlig vorbeigeht. Interessant wäre eine Adorno Deutung von so einem Satz: "Warum hätte ich eine Nase, wenn ich kein Geschlecht habe?" Wenn der Uni-Prof Beckett nicht als unleserlich für den Rest der Menschheit erklärt - die sich bekanntlich zwischen Doktoren und Nicht-Doktoren teilt - greift er zu der gemeinen psychologisierenden Erklärungen. So zum Beispiel noch einmal Deirdre Bair: "Dieses Werk ist für Beckett in diesem genauen Augenblick seines Lebens notwendig. Es hilft ihm dazu, sowohl den bevorstehenden Tod seiner Mutter zu überwinden als die Abhängigkeits- und Schuldgefühle, die seine Beziehung zu ihr schwierig machen." In diesem Zusammenhang ist Wittgenstein hilfreich: "Ich denke mir dann immer: haben diese Großen dazu so unerhört viel gelitten, daß heute ein Arschgesicht kommt & seine Meinung über sie abgibt. Dieser Gedanke erfüllt mich oft mit einer Art Hoffnungslosigkeit."
(Alban Lefranc)
Ursprung des Abstands - Wie kommt es zur Beckettschen Radikalisierung der Skepsis?
Das Ich, das in dem Namenlosen spricht, ist nicht mehr Herr seines Selbst. Das von ihm entworfene Cogito wird immer wieder abgebrochen, letztendlich kann es keine Sicherheit geben. Diese Unmöglichkeit eines Auswegs aus der Skepsis liegt meiner Ansicht nach an der unüberwindbaren Fremdbestimmung des Ich. Diese Fremdbestimmung kommt besonders durch Tiermetaphern zum Ausdruck. Die vergebliche Suche lässt das Ich wie folgt erscheinen:
"wie ein im Käfig geborenes Tier von im Käfig geborenen Tieren von im Käfig geborenen Tieren von im Käfig geborenen Tieren von im Käfig geborenen und gestorbenen Tieren im Käfig geborenen und gestorbenen von im Käfig geborenen im Käfig gestorbenen Tieren geborenen und gestorbenen im Käfig geborenen und gestorbenen im Käfig geborenen und dann gestorbenen geborenen und gestorbenen, wie ein Tier"
Hier taucht das Mittel der Wiederholung auf. Durch sie werden der Metapher Kräfte verliehen, sie lässt
die Fremdbestimmung selbst zum Ausdruck kommen, als wäre das Ich nicht mehr Herr seiner Zunge,
als wäre es besessen von diesem seinem Zustand. Die zweite Tiermetapher, die dieses Thema
problematisiert, ist die des Papageis. Für den Leser der Becketteschen Trilogie ist der Papagei ein
wohl bekanntes und meistens unverständliches Motiv. In dem Namenlosen aber steht es ganz
und gar in Zusammenhang zum Fremdbestimmungskomplex: "Ein Papagei, sie sind auf einen
Papageischnabel hereingefallen. Wenn sie mir gesagt hätten, was ich sagen muss, um Anklang zu
finden, so hätte ich es unweigerlich sagen müssen, früher oder später." Das Ich ist der Papagei, der
nur alles wiederholen kann, was ihm vorgesagt wird. Wenn er aber nur wiederholen kann, kann seine
Situation nur nach wie vor ausweglos bleiben.
Die Papageimetapher enthüllt aber eine neue
Dimension der Skepsis. Der Papagei muss wiederholen, ihm wird aber nichts vorgegeben. Die
Sprache ist es, die ihn gefangen hält, die seinen Käfig bildet. Zu Beginn des Romans schon erscheint
die Frage nach dem Ursprung der Stimme des Ich, die nicht seine sein soll. "Sie (die Stimme) bricht
aus mir hervor, sie erfüllt mich, sie schreit gegen meine Wände, es ist nicht meine, ich kann sie nicht
anhalten, ich kann sie nicht hindern, mich zu zerreißen, mich zu erschüttern, mich zu bestürmen." Die
Nicht-Verfügung über das Gesagte, über die eigene Stimme, wird oftmals betont:
"Sie haben
mich mit ihren Stimmen aufgeblasen, wie einen Ballon, selbst wenn ich mich leere, so höre ich wieder
nur sie." "Daran soll es nicht liegen, Ruhe ist ein Wort von ihnen, Denken auch." "Aber ich sage ja
nichts, ich weiß nichts, diese Stimmen sind nicht meine, auch diese Gedanken nicht, sie gehören
Feinden, die mir innewohnen."
Im Vergleich zu Descartes' Auffassung, in der der Prozess der Reflektion als rein gedanklich und
unvermittelt erscheint, ist sich das Ich bei Beckett dessen bewusst, dass alles durch die Sprache
vermittelt ist. Das Gedachte ist nicht unvermittelt gedacht, es ist in der Sprache gedacht, das heißt,
innerhalb eines Systems. Daher die Fragen des Ich: "ist ein einziges Wort von mir in allem, was ich
sage?" Und die Antwort: "Nein, ich habe keine Stimme, hier habe ich kein Stimmrecht." Das Ich ist
immer schon über die Sprache determiniert, demzufolge ist ihm unmöglich, sich selbst zu finden. Das,
was gedacht wird, und das, was gesagt wird, decken sich nicht, sind nicht auf eine Ebene zu bringen,
zwischen ihnen liegt die unüberwindbare Kluft zwischen dem Erlebten des Individuums und dem
allgemein gültigen System: "ich habe nie gesprochen, ich scheine zu sprechen, weil er ich sagt, als ob
ich es wäre, ich hätte es beinahe sogar selbst geglaubt, man höre ihn, als ob ich es wäre, ich, der ich
fern bin, der sich nicht rühren kann, den man nicht finden kann (…)."
Die Unmöglichkeit der
Selbstbestimmung und Selbsterkennung liegt in der Sprache: "es gibt keinen Namen für mich, keinen
Pronomen, alles kommt daher." Mit diesem Punkt erlangt das Ich ein Anti-Cogito, eine Erkenntnis, die
das Prinzip ist. Dieses Prinzip ist aber ein negatives: "Ich weiß, dass ich es nicht bin, das ist alles, was
ich weiß, ich sage ich, wobei ich weiß, dass ich es nicht bin, ich bin fern, das ist alles, was ich weiß
(…)." Wenn sich bei Descartes das Ich als denkende Substanz definiert, definiert es sich bei Beckett
als eine auf Grund seines Gefangenseins in der Sprache nicht-zu-denkende-, nicht-zu-findende
Substanz.
Aufgrund dieser Auffassung des Gefangenseins in der Sprache kann Beckett keinen Ausweg aus der Skepsis finden. Wenn bei Descartes ein Weg aus der Fiktion des trügerischen Gottes möglich war auf Grund des Cogito, bleibt dem Ich bei Beckett diese Möglichkeit vorenthalten, weil der trügerische Gott die Sprache selber ist, das heißt die Verbindung zwischen dem Ich und seinem Selbst. Mit der Sprache wird jede Erfahrung des Ich vermittelt - nicht nur in Bezug auf die Außenwelt, sondern auch in Bezug auf die Innenwelt: Wir sind sprachbedingte Menschen. Diese Vermittlungsinstanz ist aber unzuverlässig, sie wird dem Ich nicht gerecht, betrügt und betrübt ihn.In Anbetracht dessen entwickelt sich bei Beckett eine barocke Flucht nach vorne, wo alle Schlupflöcher wegfallen. Es gibt keine Möglichkeit eines Rückgriffs auf die Phänomene, weil die Skepsis gegenüber der Wahrnehmung unüberwindbar ist. Das Ich muss also in seinem undefinierten grauen Loch bleiben. Es gibt aber auch keine Möglichkeit des Rückgriffs auf eine Transzendenz. Diese ist ebenso machtlos wie das Ich, sie ist auch nur eine Illusion. Die Götter, die über das Schicksal des Ich entscheiden sollen, sind zerstritten, und wissen nicht, was sie mit ihrem Schützling anfangen sollen: "nebenbei gesagt, sie sind vielleicht mehrere, ein ganzes Konsortium von Tyrannen, die sich über mich nicht einig sind, seit geraumer Ewigkeit beratend, mich von zeit zu Zeit anhören, dann zum Essen gehen oder zum Skat insgeheim, auf Staatskosten, ohne mein Wissen, das wäre klarzuziehen." Hier kommt der bissige Humor Becketts zum Ausdruck - diese Darstellung der Götter erinnert eher an die Stammgäste einer alten Kneipe denn als Gestalten, die Ehrfurcht einjagen sollen. Die Existenz jener Meister wird angezweifelt: "Was er will, ist mein Wohl, ich weiß es, ich sage es jedenfalls, in der Hoffnung, ihn in eine bessere Stimmung zu versetzen, wenn er existiert, und existierend mich hört", und bald auch negiert: "Sie haben mich mit ihren Stimmen aufgeblasen, wie einen Ballon, selbst wenn ich mich leere, so höre ich wieder nur sie. Wen, sie?." Wenn die Existenz der Götter akzeptiert wird, dann sind sie lauter kleine Beamte, die immer wieder einem Vorgesetzten unterordnet sind. Alle Fragen wiederholen sich ad infinitum: "Wie viel sind wir eigentlich? Und wer spricht in diesem Moment? Und zu wem? Und worüber? Diese Fangfragen diesen zu nichts." Die Schlussfolgerung könnte dann heißen: "Es gibt also keine Hoffnung? Natürlich nicht, herrje??, was für eine Idee." Jedoch schreibt Beckett weiter, redet das Ich weiter: weil er es machen muss, als Mensch, der nur durch die Sprache lebt, und als Don Quichotte, der sich gegen die Fremdbestimmung kämpft und seine Stimme finden will.
Beckett, Descartes und die Geschichte der Vernunft
Der Namenlose kann sich als eine Bilanz der Entmachtung der Vernunft lesen, wie sie von Descartes aufgefasst worden war. Becketts Figuren entwickeln sich als Spiegelbild, als Parallele zum cartesianischen Ich, das auf der Suche nach dem Wahren ist. Diese Spiegelung erweist sich aber als zwecklos, denn die cartesianischen Prämissen - die Adequation zwischen Gesagtem und Gedachtem und das Vertrauen in die Vernunft als Leitfaden der Methode - nicht mehr gegeben sind. Sprachphilosophisch und geschichtlich gesehen kann das cartesianische Projekt nicht mehr überleben. Es wurde sowohl von den Entdeckungen der Linguistik, die seine methodologischen Mangel aufzeigen, als auch durch den konsequenten Rationalismus und Analytismus der Totalitarismen des 20. Jahrhunderts entmachtet. Beckett zieht die Konsequenz jener Entwicklung in der Beschreibung seiner vielfältigen Ich-Figur. Es hat seine Herrschaft über sich selbst verloren, denkt gar nicht erst daran, sich der Natur zu bemächtigen, und dem jede Transzendenz entzogen bleibt - schließlich ist Gott ja tot. Die Parallele zwischen den Meditationen über die erste Philosophie und dem Namenlosen machen den distopischen Charakter des cartesianischen Projekts deutlich, ebenso wie die Bilanz des Vertrauens in der Vernunft.
Bonn, September-Oktober 2001
Literatur
Beckett, Samuel:
Der Namenlose. In: Werke, Band III, Seiten 395-566, Suhrkamp Verlag Frankfurt
am Main 1976.
Descartes, René:
Meditationen über die erste Philosophie. Hg. Herausgegeben und übersetzt von
Gerhart Schmidt, Reclam Band Nr. 2888, Stuttgart 1986.
Begam, Richard Samuel:
Beckett and the end of modernity. Stanford University Press, Stanford,
California 1999.
Artuk, Simone Luise:
La conscience dans le néant à la lumière de la problématique de l'identité.
Une étude sur « L'Innommable » de Samuel Beckett. Romanistischer Verlag, Bonn, 1990.
Breuer, Rolf:
Die Kunst der Paradoxie. Sinnsuche und Scheitern bei Samuel Beckett. Wilhelm
Fink Verlag, München, 1976.
Bair, Deirdre:
Samuel Beckett. Kellner, Hamburg, 1991.
Rathjen, Friedhelm:
Beckett - Zur Einführung. Junius Verlag, Hamburg, 1995.
Engelhardt, Hartmut und Mettler, Dieter (Hg):
Materialien zu Samuel Becketts Romanen.
Suhrkamp Taschenbuch, Frankfurt am Main, 1976.
(1)
Vgl. Bair, Deirdre, Seite 120, 137: "seine einzige kontinuierliche Arbeit
bestand darin, dass er sich für kurze Zeiträume in Descartes versenkte."
(2)
Vgl. Bair, Deirdre, Seite 148: Damit beteiligte er sich an einem
Preisausschreiben, das von Freunden von ihm initiiert worden war. Becketts Darstellung der
Gedichtsgenesis an Nancy Cunard: "Whoroscope wurde in Tat für Dein Preisausschreiben
eingereicht; der Preis betrug, glaube ich, 1.000 Francs. Ich hatte keine Ahnung davon und erfuhr erst
am Nachmittag vor Ablauf der Einsendefrist davon, schrieb die erste Hälfte vor dem Abendessen, aß
einen Happen Salat und trank ein Glas Chambertin im Cochon de lait, kehrte zurück in die Ecole und
war gegen drei Uhrmorgens fertig. Dann ging ich in die Rue Guenegaud hinunter und steckte es in
deinen Briefkasten. So war das, und so war das damals.", und Seite 149, Anmerkung Bairs zu dem
Gedicht: "Im Allgemeinen stellt das Gedicht Whoroscope eine geistreiche, wenngleich oberflächliche
Zurschaustellung esoterischen Wissens dar."
(3)
Später fragt sich das Ich, ob das, was es auf dem Gesicht sieht, Tränen
oder "flüssig gewordenes Hirn" ist.
(4)
Dieser Satz Becketts hört sich wie die ironische Zuspitzung der
Meditationen an, in der Descartes sich fragt, ob er die Gestalten, die er aus dem Fenster sieht, für
Menschen halten soll - "Hieraus könnte ich ohne weiteres schließen, das Wachs werde durch das
Sehen des Auges, nicht aber durch die bloße Einsicht des Geistes erkannt. Da sehe ich gerade
zufällig Leute auf der Straße vorübergehen; ich bin gewohnt, ganz genauso wie vom Wachs zu sagen:
ich sehe sie. Was sehe ich denn außer Hüten und Kleidern, unter denen auch Automaten stecken
könnten?" Descartes, Meditationen über die erste Philosophie, Seite 93.
(5)
Rousseau, Jean-Jacques, Discours sur l'origine et les fondements de
l'inégalité parmi les hommes, Folio essai, Hg Jean Starobinski, Gallimard 1969, Seite 53: "Car ce n'est
pas une légère entreprise de démêler ce qu'il y a d'originaire et d'artificiel dans la nature actuelle de
l'homme, et de bien connaître un état qui n'existe plus, qui n'a peut-être point existé et qui n'existera
jamais, et dont il est pourtant nécessaire d'avoir des notions justes pour bien juger de notre état
présent."
(6)
Hier ist interessant zu bemerken, dass dieser Satz genau so von Beckett
hätte geschrieben werden können. Die konkrete Situation, die hier von Descartes geschildert wird,
erinnert an den Ausgangspunkt vieler Fiktionen Becketts. In Murphy hebt der Roman mit dem auf
seinem Schaukelstuhl angeschnallten Protagonist, In Molloy und Malone stirbt wird das Befinden der
Figuren im Bett dargestellt, in Gesellschaft findet man lange Erörterungen darüber, ob das Ich jetzt
nun sitzt oder steht oder auch liegt. Nicht nur die Beschreibung eines Befindens ist hier von
Bedeutung, sondern auch die dadurch entstehende Faszination für das Selbst, der Moment der
entstehenden Reflexion im Hinblick auf seine physische Lage. Dieses Befinden erweist sich aber als
unvereinbar mit dem Projekt des Ich, eine feste Grundlage für die Erkenntnis zu finden.
© das gefrorene meer - la mer gelée 2002