Am Montag ging ich zur Arbeit. Es ist immer der gleiche Weg. Ich laufe unsere Straße hinunter und überquere dann die Brücke, die mich von meiner Insel auf die andere Insel bringt. Gewaltsam erscheint die Kathedrale. Langsam rückt sie hinter einer Wand aus Häusern hervor. Zuerst taucht die Apsis auf, dann sind auch die Türme zu sehen. Wie Monster steigen sie über mir in die Höhe. Ich biege nach rechts ab und führe meinen Weg fort, im Stechschritt durchschreite ich die Kolonnade der Kastanien. Und im Schatten der Türme, unter dem Hohngelächter der Wasserspeier, öffne ich die Tür. Ich überquere den Hof, trete durch eine weitere Tür, steige die Treppen hinauf und entriegle meinen Spind. Ich ziehe den weißen Kittel mit den groben Taschen heraus und tausche ihn gegen meine Weste ein. Ich bin Arzt. Das ist mein Beruf und mein Leben. Jedenfalls auf dieser Insel. Auf der anderen Insel. Auf meiner Insel bin ich Kellner in einem kleinen Restaurant. Aber dieses hier ist die andere Insel.
 Ich wollte meiner Mutter nicht wehtun. Sie verstand wohl, dass ich mir von meinem Leben mehr versprach, als Kellner in einem Restaurant zu sein, weshalb sie mir das Studium gern zugestand. Aber das Restaurant bedeutet ihr alles. Es war stets im Besitz der Familie - über all die Jahrzehnte hinweg. Vor fünf Jahren ist mein Vater gestorben, ihr geliebter Mann. Ich habe weder Bruder noch Schwester, und so lag es an mir, ihn zu ersetzen – oder das Herz meiner Mutter zu zerbrechen. Ich fügte mich in die Umstände und suchte eine Anstellung, die mit den Wünschen meiner Mutter und der Arbeit im Restaurant vereinbar war. Die andere Insel liegt nah bei der unseren, nur eine Brücke trennt die beiden voneinander. Seither bin ich Arzt auf der anderen Insel. Seither habe ich zwei Berufe und zwei Leben, aufgeteilt auf die beiden Inseln und einzig verbunden durch die Brücke zwischen ihnen. Manchmal, um es denn auszusprechen, scheint mir alles in Stücke zertrennt. Manchmal scheint mir alles zerbrochen - und doch: zum Glück. Zum Glück ist mein Leben auf die beiden Inseln verteilt. Denn niemals könnte ich meinen Beruf auf unserer Insel ausüben. Ich kann es nur auf der anderen Insel tun. Ich begrüße die Sekretärinnen, dann öffne ich die Tür zum Überwachungssaal, beobachte den Bildschirm und warte darauf, dass sie kommen. Auf dem Bildschirm erscheint, was die Kamera im Flur des Erdgeschosses und im Warteraum aufzeichnet. Wenn sie eingetroffen sind, warte ich noch einige Minuten, bis die Schwester alles vorbereitet hat. Dann steige ich die Treppen hinab. Die Angekommenen sind eine Gruppe von Polizisten und ein Verbrecher. Ich bin Polizeiarzt. Das heißt, ich bin autonomer Arzt, aber ich arbeite als Arzt für die Polizei. Ich beantworte ihre Fragen. Meistens beantworte ich die Frage, ob der Gesundheitszustand der Verbrecher, die sie zu mir bringt, mit den Bedingungen des Polizeigewahrsams vereinbar ist. Ansonsten verbindet uns nichts und man kann sagen, die Polizei und ich leben in völlig getrennten Welten.
Ich wollte meiner Mutter nicht wehtun. Sie verstand wohl, dass ich mir von meinem Leben mehr versprach, als Kellner in einem Restaurant zu sein, weshalb sie mir das Studium gern zugestand. Aber das Restaurant bedeutet ihr alles. Es war stets im Besitz der Familie - über all die Jahrzehnte hinweg. Vor fünf Jahren ist mein Vater gestorben, ihr geliebter Mann. Ich habe weder Bruder noch Schwester, und so lag es an mir, ihn zu ersetzen – oder das Herz meiner Mutter zu zerbrechen. Ich fügte mich in die Umstände und suchte eine Anstellung, die mit den Wünschen meiner Mutter und der Arbeit im Restaurant vereinbar war. Die andere Insel liegt nah bei der unseren, nur eine Brücke trennt die beiden voneinander. Seither bin ich Arzt auf der anderen Insel. Seither habe ich zwei Berufe und zwei Leben, aufgeteilt auf die beiden Inseln und einzig verbunden durch die Brücke zwischen ihnen. Manchmal, um es denn auszusprechen, scheint mir alles in Stücke zertrennt. Manchmal scheint mir alles zerbrochen - und doch: zum Glück. Zum Glück ist mein Leben auf die beiden Inseln verteilt. Denn niemals könnte ich meinen Beruf auf unserer Insel ausüben. Ich kann es nur auf der anderen Insel tun. Ich begrüße die Sekretärinnen, dann öffne ich die Tür zum Überwachungssaal, beobachte den Bildschirm und warte darauf, dass sie kommen. Auf dem Bildschirm erscheint, was die Kamera im Flur des Erdgeschosses und im Warteraum aufzeichnet. Wenn sie eingetroffen sind, warte ich noch einige Minuten, bis die Schwester alles vorbereitet hat. Dann steige ich die Treppen hinab. Die Angekommenen sind eine Gruppe von Polizisten und ein Verbrecher. Ich bin Polizeiarzt. Das heißt, ich bin autonomer Arzt, aber ich arbeite als Arzt für die Polizei. Ich beantworte ihre Fragen. Meistens beantworte ich die Frage, ob der Gesundheitszustand der Verbrecher, die sie zu mir bringt, mit den Bedingungen des Polizeigewahrsams vereinbar ist. Ansonsten verbindet uns nichts und man kann sagen, die Polizei und ich leben in völlig getrennten Welten. Ich weiß, wovon ich spreche, wenn ich sage, dass es ein beeindruckendes Bild ist, drei, vier oder gar fünf Polizisten zu sehen, in ihren steifen, dunklen, schlecht sitzenden Uniformen, wie sie, bewaffnet mit Pistole, Schlagstock und Handschellen, einen einzigen, alltäglich gekleideten Kriminellen heranführen, dem die Hände auf dem Rücken gefesselt sind. Es ist ein so direktes Bild von Übermacht, wie man es selten erblickt. Zu Beginn war ich perplex. Ich habe meine Kindheit und Jugend auf den beiden Inseln verbracht, aber nie irgendwo einen Kriminellen gesehen. Doch nun, inmitten dieser Stätten, kommen sie in Massen an, Tag und Nacht. Am Anfang habe ich mich gefragt, welchen Weg sie wohl nehmen, welchen versteckten Weg, aber ich fand keine Antwort und gab die Suche danach auf.
Ich stelle Bescheinigungen aus. Die Schwester hat die Bescheinigung vorbereitet und auf meinen Tisch gelegt. Dann folgt das Ritual. Ich rufe den Namen und sie kommen näher, die Polizisten und der Kriminelle, ich stehe im Türrahmen, sie draußen im Flur, und einer der Polizisten fragt:
„Losketten?“
„Aber ja doch“
Das ist das Ritual. Ihre Frage und meine Antwort. Denn es gibt nichts zu fragen und nichts zu antworten. Man kann niemanden sachgerecht untersuchen, dessen Hände auf dem Rücken gefesselt sind und falls je einen Grund dafür bestehen sollte, den Kriminellen dennoch nicht loszuketten, so ist es Sache der Polizisten darum zu wissen, nicht meine, denn wir arbeiten hier auf autonome und getrennte Weise und ich weiß absolut nicht, warum und in welchem Ausmaß die Kriminellen, die ich untersuche, kriminell sind. Das wissen die Polizisten, nicht ich. Außerdem vertraue ich darauf, dass sie die Taschen der Kriminellen geleert haben und dass sie einschreiten, wenn es je nötig sein sollte. Schließlich sind sie dafür ausgerüstet.
Ich stelle Bescheinigungen aus. Die Bescheinigung gibt drei Linien für die Beschwerden vor, fünf Linien für den Untersuchungsbefund und am unteren Rand zwei Rubriken zum Ankreuzen: „vereinbar“ oder „nicht vereinbar“.
Anfangs habe ich die Kriminellen gefragt, wie es ihnen geht. Aber ich habe die Frage aufgegeben, weil dieser Fakt völlig belanglos ist. Ich stelle Bescheinigungen aus, aus denen ein „Vereinbar“ oder ein „Nicht vereinbar“ hervorgeht, das ist alles. Deshalb ist es ohne Nutzen zu wissen, wie es ihnen abgesehen davon geht, denn es ändert an der Bescheinigung nichts und ich sehe sie nach den fünf Minuten, die es mich kostet, die Bescheinigung auszustellen ohnehin nie mehr wieder. Die Dinge sind getrennt hier. Die Medizin und die Justiz sind getrennt und die Polizisten und die Kriminellen sind es ebenfalls, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht. Wie kann es mich da interessieren, welche Lebensgeschichten mir mit den Kriminellen gegenüberstehen? Ich bin hier, um Bescheinigungen auszustellen. Gewiss, man könnte einwenden, dass die Bescheinigungen unangemessen sind. Aber sie sind, wie sie sind. Ich habe sie nicht gemacht.
Ich fange mit den Beschwerden an. Ich notiere: hat Angst, hat Schmerzen, fühlt sich eingesperrt, klagt über Schlafstörungen, leidet an Panikattacken, klagt über Hitzewallungen und Schüttelfrost, hat Magenbrennen, hat Atembeschwerden und so weiter. Dann untersuche ich. Ich prüfe den Blutdruck, ich höre das Herz ab, es macht toktoktok, ich höre die Lungen ab, es macht chhrchhrh, ich drücke auf den Bauch, ich leuchte in die Pupillen, sie schrumpfen. Das notiere ich auf den fünf Linien. Dann kreuze ich in aller Regel die Rubrik „vereinbar“ an und streiche die andere durch.
Am Anfang war ich geneigt, auch die roten Abdrücke an den Handgelenken zu notieren, denn aus meiner Sicht besteht kein Grund, die Handschellen so fest anzuziehen, dass sie Abdrücke hinterlassen und den Kriminellen Schmerzen bereiten. Auch locker angelegte Handschellen können nicht über die Hände gestreift werden. Es handelt sich dabei um das gleiche Prinzip wie bei gewöhnlichen Fingerringen, die auch keine Wunden hinterlassen, und dennoch nicht von den Fingern fallen. Aber auch das wundert mich nicht mehr. Ich verspüre nicht länger das Bedürfnis, die roten Abdrücke an den Handgelenken zu notieren, denn ich habe sie zu oft gesehen und mich endlich an ihren Anblick gewöhnt. Außerdem sage ich mir, dass mich das nichts angeht und dass die Polizisten wie ich ihren Beruf gelernt haben und folglich wissen müssen, wie man Handschellen korrekt anlegt.
Schließlich stelle ich den Kriminellen ein Rezept aus, entsprechend den Beschwerden und dem Untersuchungsbefund. Ich verschreibe fast ausschließlich Medikamente gegen Schmerzen, Angst, Magenbrennen, Atemnot, Schlaflosigkeit, Heroinentzug und Nervenkrisen. Alles geht sehr schnell. Außer, wenn ich Methadon verordne. Das dauert. Denn es gibt keine Methadonreserve in der Polizeiabteilung und die Ausgabebedingungen sind sehr streng. Laut Vorschrift muss das Methadon mit einem blutroten, nummerierten und vielfach abgestempelten Sonderrezept aus der Sicherheitsabteilung der Apotheke geholt und in meinem Beisein sofort an den Süchtigen verabreicht werden. So geschieht es immer wieder, dass der Kriminelle bereits erneut für den Abtransport vorbereitet ist, wenn das Methadon endlich gebracht wird, ihm also die Hände auf dem Rücken gefesselt sind. In diesem Fall öffne ich das Methadongefäß selbst und schütte den Inhalt persönlich in den Mund des Kriminellen. Am Anfang kam mir das wie eine Art Hinrichtung vor, aber ich habe mich daran gewöhnt und finde es jetzt weniger schlimm.
Übrigens dauert die Verabreichung des Methadons in jedem Fall ziemlich lang. Es ist anrührend zu beobachten, wie die Süchtigen das geleerte Gefäß noch einmal mit Wasser füllen lassen, um ganz sicher zu gehen, dass sie seinen Inhalt vollständig geschluckt haben. Denn für einen Süchtigen ist das Wichtigste im Leben: die volle Dosis zu bekommen. Alles andere verblasst vor diesem Verlangen. Es gibt drei Medikamente, von denen ich weiß, dass Kranke bereit sind, sich vor einem Arzt auf die Knie zu werfen, um sie zu erhalten: Morphium gegen Schmerzen, Valium gegen Angst und Methadon gegen den Horror des Entzugs. Alle drei sind gleichbedeutend mit der Voraussetzung, weiterexistieren zu können. Zu Beginn erfüllte mich manches, was ich hier beobachtete, mit Ekel, aber ich habe mich daran gewöhnt und schließlich gibt es auch die Opfer.
Die Opfer beklagen fast alle das gleiche Schicksal. Und in den meisten Fällen lügen sie nicht. Sie erhalten Faustschläge ins Gesicht bis sie umfallen, und wenn sie umgefallen sind, werden die Faustschläge von Fußtritten abgelöst. Die Angreifer wählen stets die wirkungsvollste und zugleich müheloseste Angriffsart. Die Opfer kommen in Tränen aufgelöst zu mir, sie zittern und weinen, stammeln und sind konsterniert, sie fassen nicht was ihnen zugestoßen ist und beteuern immer wieder, scheinbar weil es ihnen nicht in den Kopf geht, dass ihnen niemand geholfen hat, obwohl es Zeugen gab, die alles gesehen haben, aber sie sagen, die Zeugen hätten nur herumgestanden und zugeschaut. Nach allem, was mir die Opfer anvertrauen, warten die Herumstehenden ab, bis der Angriff ein Ende hat, dann eilen sie herbei, um das Opfer wieder auf die Beine zu stellen und es zur Polizei zu begleiten. Nachdem ich mir die Klagen angehört habe, zähle ich die Blutergüsse, die Hautabschürfungen, Schnitte, Knochenbrüche, stelle das Ausmaß des Zitterns, des Weinens, der Angst fest, notiere alles und stelle eine Bescheinigung aus.
Diejenigen, die lügen, sind die Eltern, die mit ihren Kindern von den Polizisten zu mir gebracht werden. Sie behaupten, die Wunden ihrer Kinder rührten von versehentlichen Unfällen her. Aber es ist sinnlos, mich zu belügen. Ich weiß, wer lügt und wer die Wahrheit sagt, noch bevor ich ein Kind untersucht habe. Und ich täusche mich nicht. Ich täusche mich niemals. Mag sein, dass meine Arbeit kein großes Ansehen genießt, aber ich habe gelernt, sie mit Perfektion auszuüben. Denn niemand kann mich täuschen. Ein einziger Blick in die Augen der Eltern reicht aus, um zu wissen, ob sie ehrlich sind oder ob sie lügen, und erst recht weiß ich es, nachdem sie das erste Wort über die Lippen gebracht haben. Ich kenne den Blick und den Klang der Stimmen jener, die lügen und jener, die mir die Wahrheit sagen. Ich täusche mich nicht. Ich täusche mich niemals. Ich bin der Meister der Spuren. Ich weiß alles.
 Am Dienstag hatte ich Geburtstag. Es war der zweiunddreißigste. Ich lief wie stets im Stechschritt durch die Kolonnade der Kastanien, unter dem Hohngelächter der Wasserspeier näherte ich mich dem weißen Kittel mit den großen Taschen. Doch plötzlich erfasste mich Widerwille. Ich stoppte. Und kehrte um. Ich sagte mir, dass ich das Recht dazu hätte, weil mein Geburtstag war. Obwohl mir davon nichts zu erwarten blieb. Mein Geschenk, eine Uhr, hatte mir meine Mutter schon vor fast einer Woche gegeben. Sie hatte meinen Geburtstag mit einem anderen Tag verwechselt. Ich kehrte um und ging in die entgegengesetzte Richtung, wählte meinen gewohnten Gängen zuwiderlaufende Wege und bog in ein Gässchen ein, das zu beiden Seiten von schmalen, mittelalterlichen Häusern gesäumt war. Zwischen den nebeneinander gedrängten, von Holz durchgliederten Gebäuden mit ihren steilen, spitzen Dächern fühlte ich mich wohl. Immer noch war ich sehr nah bei der Kathedrale. Hin und wieder lugte ihre schwere Rosettenfront durch Häuserlücken hindurch. Endlich stieg ich zu den Kais am Fluss hinab. Auf dem grauen Wasser des Flusses trieben zwei Schwäne. Sie schwammen, ohne einander je zu verlassen, nebeneinander her. Über die Mauer des Kais lehnte ein alter Mann. Er trug einen dicken Mantel und blickte still auf einen Punkt im Wasser. Auf Schleichwegen ging ich zurück zu der großen Steinbrücke, die mich zu meiner Insel hinüberbringt. Unterwegs fiel mein Blick erneut auf die Kathedrale. Golden strahlte sie im Licht der Frühe. Aus der Ferne machte sie mir weniger Sorgen. Ich schaute auf das von den Türmen abgewandte Ende, auf die wie Kristalle gewinkelten Streben der Apsis - im strahlenden Glanz eines Wintermorgens, in seiner Ruhe, seiner Kälte, und ich ging weiter, ging von meiner Insel über den Hauptboulevard und folgte ihm ein Stück, bis ich am tiefen Ende der Häuserflucht das Dach des Domes erkannte, eine halbrunde, silberne Kuppel im Himmel. Ich stieg zur Pforte hinauf. Auf dem Platz davor war ein kleiner, künstlicher Tannenwald angelegt. Die Äste der Bäume und der Boden schimmerten weiß von künstlichem Schnee. Darüber wölbte sich das Oval des Bauwerks. Es war von einer Schlichtheit und Harmonie, die mich tief berührte. Ich setzte meinen Gang fort. Ich irrte durch die Winterstadt. Sonst hatte ich nichts zu tun. Ich irrte durch die Winterstadt bis zum Einbruch der Nacht.
Am Dienstag hatte ich Geburtstag. Es war der zweiunddreißigste. Ich lief wie stets im Stechschritt durch die Kolonnade der Kastanien, unter dem Hohngelächter der Wasserspeier näherte ich mich dem weißen Kittel mit den großen Taschen. Doch plötzlich erfasste mich Widerwille. Ich stoppte. Und kehrte um. Ich sagte mir, dass ich das Recht dazu hätte, weil mein Geburtstag war. Obwohl mir davon nichts zu erwarten blieb. Mein Geschenk, eine Uhr, hatte mir meine Mutter schon vor fast einer Woche gegeben. Sie hatte meinen Geburtstag mit einem anderen Tag verwechselt. Ich kehrte um und ging in die entgegengesetzte Richtung, wählte meinen gewohnten Gängen zuwiderlaufende Wege und bog in ein Gässchen ein, das zu beiden Seiten von schmalen, mittelalterlichen Häusern gesäumt war. Zwischen den nebeneinander gedrängten, von Holz durchgliederten Gebäuden mit ihren steilen, spitzen Dächern fühlte ich mich wohl. Immer noch war ich sehr nah bei der Kathedrale. Hin und wieder lugte ihre schwere Rosettenfront durch Häuserlücken hindurch. Endlich stieg ich zu den Kais am Fluss hinab. Auf dem grauen Wasser des Flusses trieben zwei Schwäne. Sie schwammen, ohne einander je zu verlassen, nebeneinander her. Über die Mauer des Kais lehnte ein alter Mann. Er trug einen dicken Mantel und blickte still auf einen Punkt im Wasser. Auf Schleichwegen ging ich zurück zu der großen Steinbrücke, die mich zu meiner Insel hinüberbringt. Unterwegs fiel mein Blick erneut auf die Kathedrale. Golden strahlte sie im Licht der Frühe. Aus der Ferne machte sie mir weniger Sorgen. Ich schaute auf das von den Türmen abgewandte Ende, auf die wie Kristalle gewinkelten Streben der Apsis - im strahlenden Glanz eines Wintermorgens, in seiner Ruhe, seiner Kälte, und ich ging weiter, ging von meiner Insel über den Hauptboulevard und folgte ihm ein Stück, bis ich am tiefen Ende der Häuserflucht das Dach des Domes erkannte, eine halbrunde, silberne Kuppel im Himmel. Ich stieg zur Pforte hinauf. Auf dem Platz davor war ein kleiner, künstlicher Tannenwald angelegt. Die Äste der Bäume und der Boden schimmerten weiß von künstlichem Schnee. Darüber wölbte sich das Oval des Bauwerks. Es war von einer Schlichtheit und Harmonie, die mich tief berührte. Ich setzte meinen Gang fort. Ich irrte durch die Winterstadt. Sonst hatte ich nichts zu tun. Ich irrte durch die Winterstadt bis zum Einbruch der Nacht. Es gibt Kriminelle, die weder von Polizisten hergeführt werden noch gefesselt sind. Völlig ungestört spazieren sie im Gang des Erdgeschosses umher. Am Anfang hatte mich diese Sorte von Kriminellen in großes Staunen versetzt. Aber es sind ja keine Kriminellen. Es sind Kriminelle, die nur so tun als ob, aber in Wirklichkeit sind sie auf unserer Seite. „Das sind als Delinquenten verkleidete Agenten, die das Milieu infiltrieren sollen“, wurde mir erklärt.
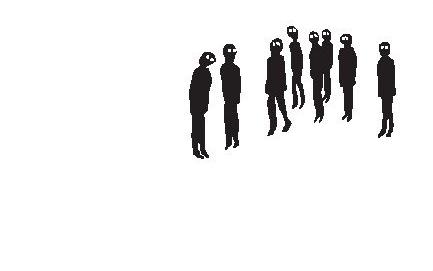 „Wissen Sie“, sagte eine der Schwestern, „das sind ganz raffinierte Leute. Sie setzen sich zum Beispiel im Zug neben dich und tun so, als gehörten sie zu dir, als seien sie mit dir auf der gleichen Wellenlänge. So bringen sie dich zum reden, um Informationen aus dir herauszukitzeln … Bis du ein bisschen zu viel geredet hast und dann, schnapp, ziehen sie die Handschellen aus der Tasche. So geht das.“
„Wissen Sie“, sagte eine der Schwestern, „das sind ganz raffinierte Leute. Sie setzen sich zum Beispiel im Zug neben dich und tun so, als gehörten sie zu dir, als seien sie mit dir auf der gleichen Wellenlänge. So bringen sie dich zum reden, um Informationen aus dir herauszukitzeln … Bis du ein bisschen zu viel geredet hast und dann, schnapp, ziehen sie die Handschellen aus der Tasche. So geht das.“ Mit der Zeit habe ich mich an alles gewöhnt, aber nicht an die Agenten. Die Agenten haben mich verändert. Sie haben mir eine Wunde beigebracht, die nicht mehr heilt. Denn in dem Moment, als ich ihr Wirken durchschaute, ihren routinemäßigen Verrat, geriet etwas in meinem Innersten in Unordnung. Seitdem ziehe ich mich mehr und mehr in mich selbst zurück, ähnlich einer jener hölzernen Puppen, die in sich stets eine noch kleinere verbergen, und Mal um Mal schrumpfen, wenn man ihre Schalen öffnet. Ich weiß nicht mehr, mit wem ich spreche, seit ich das Wesen der Agenten erkannt habe - weiß nicht mehr, ob ich denjenigen vor mir habe, mit dem ich zu sprechen glaube, oder einen Agenten. Denn jeder könnte ein Agent sein. Die Agenten haben die Grundbegriffe meines Verstehens außer Kraft gesetzt. Denn ich kann sie nicht erkennen. Außer ich verdächtige. Wenn ich bis zum Äußersten verdächtige, dann scheint es mir, als könne ich sogar die Agenten erkennen und sie von den anderen unterscheiden. Aber man kann nicht immerzu verdächtigen. Deshalb muss man vor ihnen fliehen, indem man selbst nur so tut als ob, selbst zum Phantom wird, sich selbst in sich selbst wie die Puppe in der Puppe versteckt. Natürlich ist das nicht möglich. Man bleibt, wer man ist. Aber ich glaube daran, wenigstens zu einer der inneren Puppen werden zu können, zu einem Ich-Selbst-In-Mir-Selbst unter einer falschen Haut. Dann blieben nur noch zwei Phantome, die sich begegnen und miteinander sprechen - der Agent und ich, sein Trug und meine falsche Haut, die äußerste, die große Puppe.